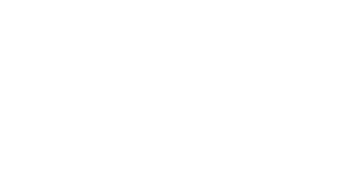.
Auf einer Reise zu den Lapislazuli-Minen in Afghanistan Anfang der 1980er-Jahre begegnete mir ein junger Mann aus der Gemeinschaft der Wakhi.
Diese Gruppe stellt die Mehrheit der Bevölkerung im Wakhan-Tal. Die Wakhi sind eine iranischsprachige Volksgruppe und sprechen Wakhi, eine östliche iranische Sprache. Sie leben hauptsächlich von Landwirtschaft und Viehzucht in dieser abgelegenen, bergigen Region Afghanistans. Der Wakhan-Korridor ist ein schmaler Streifen Afghanistans, der sich im äußersten Nordosten des Landes bis an die Grenze zu China erstreckt. Er ist spärlich besiedelt, mit kleinen Ansammlungen von Lehmhäusern, die sich entlang des Tals versteckt an den Rücken des Hindukusch und Pamir klammern.
„Warum suchst du nach Lapislazuli?“, fragte er mich. „Der weibliche Lapislazuli ist doch so viel schöner.“
Müde von der Fahrt und neugierig auf die Begegnung willigte ich dankend ein und begleitete ihn, die Hauptstraße verlassend, in ein verstecktes Dorf.
Dort wurde ich aufs Herzlichste von einer Gruppe von Bewohnern begrüßt, die schon seit Langem wussten, dass sich ein Deutscher auf dem Weg durch das Tal befand. Zunächst versorgten sie mich mit Tee und Brot.
Der junge Mann, der recht gut Englisch sprach, erzählte von unserer Begegnung und stellte mir dann allerlei Fragen aus der Gruppe, die er für mich übersetzte.
Als ich das Ziel und den Inhalt meiner Reise erklärte, erhielt ich als Antwort nur mitleidiges Lächeln und bedauerndes Kopfschütteln.
„Female Lapis Lazhward“, war die Antwort.
„Weibliches Steinblau“ wäre die Übersetzung aus drei Sprachen (Englisch, Lateinisch, Persisch).
Dieser besondere Schatz wird nicht mit Sklaven, Dynamit und Eisen aus tiefen Minen der Mutter Erde entrissen.
Er wird mit den Händen der Frauen in den Lehmöfen der kargen Häuser geschaffen – mit Geräten aus der Küche sowie Materialien aus den Bergen und Feldern. Seit Jahrtausenden ist es so selbstverständlich, dass es keiner Niederschrift bedarf.
Ein Gänsefußgewächs mit dem Namen Quashath wird getrocknet und zu weißer Asche verbrannt. Sand aus dem Fluss wird in einem Kupfermörser zu feinem Puder zermahlen und mit Baumgummi zu einem kleinen Körper geformt. Dieses Objekt wird nun in einem Bett aus Quashath-Asche in eine Kugel aus Tonerde gebettet.
Die Kugel wird dem Küchenlehmofen übergeben und bleibt über Nacht in der Glut.
Am nächsten Morgen wird sie geöffnet – und in der Asche liegt, in einem pudernden Bett, ein kleiner, strahlend blauer Körper.
Entstaubt, gewaschen und befreit von allem, bleibt so ein blauer, strahlender Schatz.